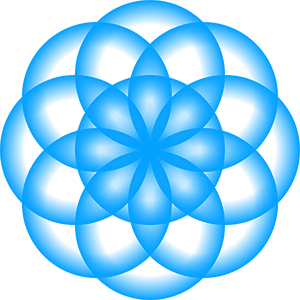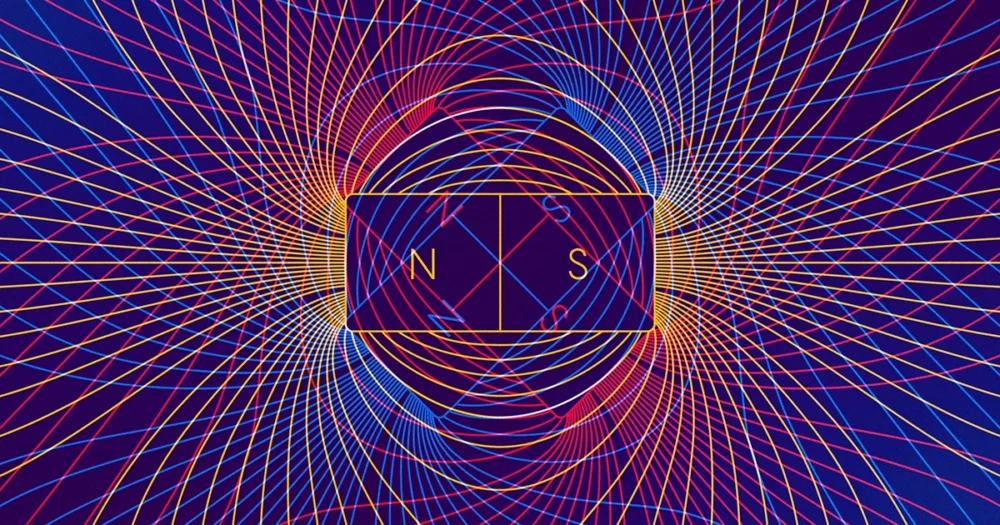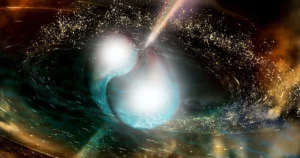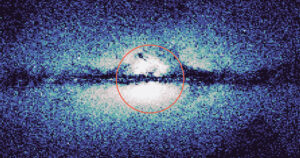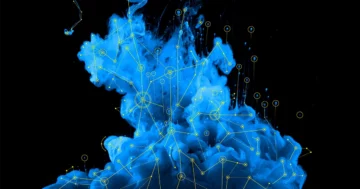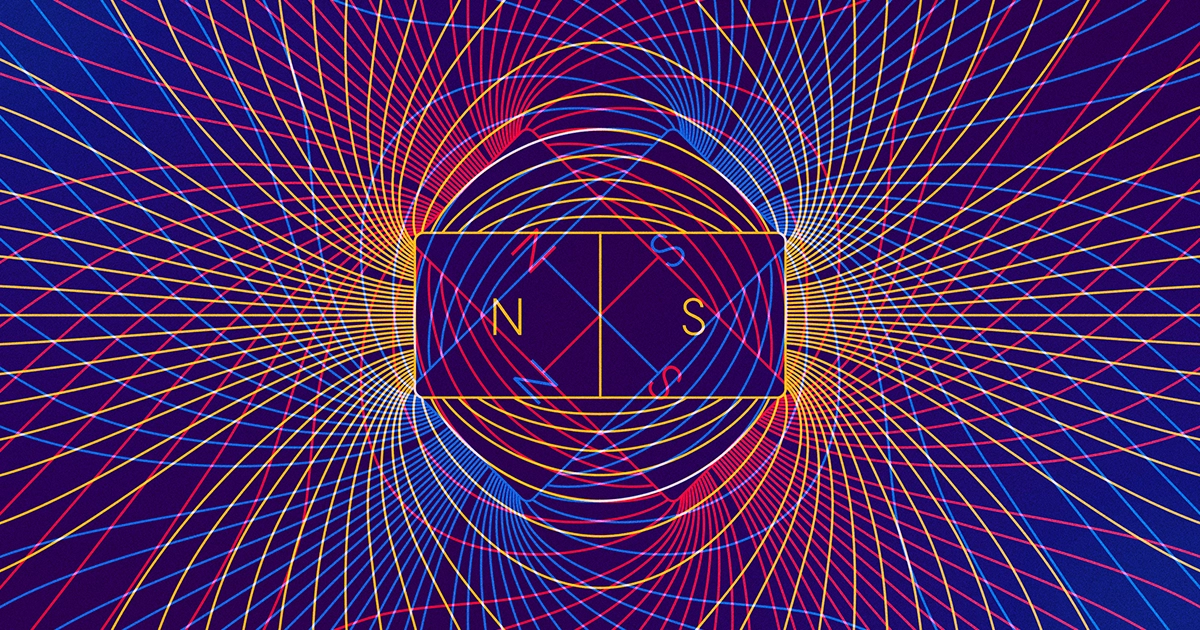
Einleitung
Alle Magnete, mit denen Sie jemals interagiert haben, wie zum Beispiel die an Ihrer Kühlschranktür geklebten Magnete, sind aus demselben Grund magnetisch. Aber was wäre, wenn es eine andere, seltsamere Möglichkeit gäbe, ein Material magnetisch zu machen?
1966 erfand der japanische Physiker Yosuke Nagaoka eine Art Magnetismus erzeugt durch einen scheinbar unnatürlichen Tanz von Elektronen in einem hypothetischen Material. Jetzt hat ein Team von Physikern eine Version von Nagaokas Vorhersagen entdeckt, die sich in einem künstlich hergestellten Material mit einer Dicke von nur sechs Atomen abspielt.
Die Entdeckung, vor kurzem in der Zeitschrift veröffentlicht Naturist der jüngste Fortschritt in der fünf Jahrzehnte währenden Suche nach dem Nagaoka-Ferromagnetismus, bei dem ein Material im Gegensatz zu herkömmlichen Magneten magnetisiert wird, wenn die darin enthaltenen Elektronen ihre kinetische Energie minimieren. „Deshalb mache ich diese Art von Forschung: Ich kann Dinge lernen, die wir vorher nicht wussten, Dinge sehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben“, sagte der Co-Autor der Studie Livio Ciorciaro, der die Arbeit als Doktorand am Institut für Quantenelektronik der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich fertigstellte.
In 2020, Forscher schufen den Nagaoka-Ferromagnetismus in einem winzigen System mit nur drei Elektronen, einem der kleinstmöglichen Systeme, in denen das Phänomen auftreten kann. In der neuen Studie haben Ciorciaro und seine Kollegen dies in einem erweiterten System ermöglicht – einer gemusterten Struktur namens Moiré-Gitter, die aus zwei nanometerdünnen Schichten besteht.
Diese Studie „ist eine wirklich coole Verwendung dieser Moiré-Gitter, die relativ neu sind“, sagte er Juan Pablo Dehollain, ein Co-Autor der Studie aus dem Jahr 2020, der die Arbeit an der Technischen Universität Delft abgeschlossen hat. „Es betrachtet diesen Ferromagnetismus auf eine ganz andere Art und Weise.“
Wenn Ihre parallelen Drehungen dazu führen, dass ein Feld beginnt
Der traditionelle Ferromagnetismus entsteht, weil Elektronen einander nicht besonders mögen und daher kein Verlangen danach haben, sich zu treffen.
Stellen Sie sich zwei Elektronen vor, die nebeneinander sitzen. Sie stoßen sich gegenseitig ab, weil sie beide negative elektrische Ladungen haben. In ihrem Zustand mit der niedrigsten Energie sind sie weit voneinander entfernt. Und Systeme pendeln sich in der Regel in ihrem Zustand mit der niedrigsten Energie ein.
Laut Quantenmechanik haben Elektronen noch einige andere entscheidende Eigenschaften. Erstens verhalten sie sich weniger wie einzelne Punkte, sondern eher wie probabilistische Nebelwolken. Zweitens haben sie eine Quanteneigenschaft namens Spin, die so etwas wie ein innerer Magnet ist, der nach oben oder unten zeigen kann. Und drittens können sich zwei Elektronen nicht im selben Quantenzustand befinden.
Das hat zur Folge, dass Elektronen mit demselben Spin unbedingt voneinander weg wollen – wenn sie sich am selben Ort und mit demselben Spin befinden, besteht die Gefahr, dass sie denselben Quantenzustand einnehmen. Überlappende Elektronen mit parallelen Spins bleiben etwas weiter voneinander entfernt als sonst.
Bei Vorhandensein eines externen Magnetfelds kann dieses Phänomen stark genug sein, um Elektronenspins dazu zu bringen, sich wie kleine Stabmagnete auszurichten und so ein makroskopisches Magnetfeld im Material zu erzeugen. In Metallen wie Eisen sind diese Elektronenwechselwirkungen, die Austauschwechselwirkungen genannt werden, so stark, dass die induzierte Magnetisierung dauerhaft ist, solange das Metall nicht zu stark erhitzt wird.
„Der eigentliche Grund dafür, dass wir in unserem täglichen Leben Magnetismus haben, liegt in der Stärke der Elektronenaustauschwechselwirkungen“, sagte der Co-Autor der Studie Ataç Imamoğlu, Physiker ebenfalls am Institut für Quantenelektronik.
Doch wie Nagaoka in den 1960er Jahren theoretisierte, sind Austauschwechselwirkungen möglicherweise nicht die einzige Möglichkeit, ein Material magnetisch zu machen. Nagaoka stellte sich ein quadratisches, zweidimensionales Gitter vor, in dem jeder Platz im Gitter nur ein Elektron hatte. Dann hat er herausgefunden, was passieren würde, wenn man unter bestimmten Bedingungen eines dieser Elektronen entfernen würde. Während die verbleibenden Elektronen des Gitters miteinander interagierten, schwebte das Loch, in dem sich das fehlende Elektron befunden hatte, um das Gitter herum.
In Nagaokas Szenario wäre die Gesamtenergie des Gitters am niedrigsten, wenn alle Elektronenspins ausgerichtet wären. Jede Elektronenkonfiguration würde gleich aussehen – als wären die Elektronen identische Kacheln in den langweiligsten der Welt Schiebepuzzle. Diese parallelen Spins würden wiederum das Material ferromagnetisch machen.
Wenn zwei Gitter mit einer Drehung ein Muster erzeugen
İmamoğlu und seine Kollegen ahnten, dass sie Nagaoka-Magnetismus erzeugen könnten, indem sie mit einschichtigen Atomschichten experimentierten, die zu einem komplizierten Moiré-Muster (ausgesprochen: mwah-ray). In atomar dünnen, geschichteten Materialien können Moiré-Muster das Verhalten der Elektronen – und damit der Materialien – radikal verändern. So zum Beispiel im Jahr 2018 der Physiker Pablo Jarillo-Herrero und seine Kollegen weisen nach, dass dass zweischichtige Graphenstapel die Fähigkeit zur Supraleitung erlangten, wenn sie die beiden Schichten durch eine Drehung versetzten.
Moiré-Materialien haben sich seitdem zu einem überzeugenden neuen System zur Untersuchung des Magnetismus entwickelt, das neben Wolken aus unterkühlten Atomen und komplexen Materialien wie Kupraten eingesetzt wird. „Moiré-Materialien bieten uns im Grunde einen Spielplatz für die Synthese und Untersuchung von Vielteilchenzuständen von Elektronen“, sagte İmamoğlu.
Die Forscher begannen mit der Synthese eines Materials aus Monoschichten der Halbleiter Molybdändiselenid und Wolframdisulfid, die zu einer Materialklasse gehören, die vergangene Simulationen hatte angedeutet, dass er Magnetismus im Nagaoka-Stil aufweisen könnte. Anschließend legten sie schwache Magnetfelder unterschiedlicher Stärke an das Moiré-Material an und verfolgten gleichzeitig, wie viele Elektronenspins des Materials sich an den Feldern ausrichteten.
Anschließend wiederholten die Forscher diese Messungen, während sie unterschiedliche Spannungen an das Material anlegten, was die Anzahl der Elektronen im Moiré-Gitter veränderte. Sie fanden etwas Seltsames. Das Material neigte nur dann eher dazu, sich an ein äußeres Magnetfeld anzupassen, sich also ferromagnetischer zu verhalten, als es bis zu 50 % mehr Elektronen hatte, als es Gitterplätze gab. Und wenn das Gitter weniger Elektronen als Gitterplätze hatte, sahen die Forscher keine Anzeichen von Ferromagnetismus. Dies war das Gegenteil von dem, was sie erwartet hätten, wenn der standardmäßige Nagaoka-Ferromagnetismus am Werk gewesen wäre.
Obwohl das Material magnetisierend war, schienen Austauschwechselwirkungen es nicht anzutreiben. Aber auch die einfachsten Versionen von Nagaokas Theorie erklärten seine magnetischen Eigenschaften nicht vollständig.
Wenn Ihre Sachen magnetisiert werden und Sie etwas überrascht sind
Letztlich kam es auf die Bewegung an. Elektronen verringern ihre kinetische Energie, indem sie sich im Raum ausbreiten, was dazu führen kann, dass sich die Wellenfunktion, die den Quantenzustand eines Elektrons beschreibt, mit denen seiner Nachbarn überlappt und so deren Schicksale miteinander verbindet. Sobald im Material des Teams mehr Elektronen im Moiré-Gitter vorhanden waren als Gitterplätze vorhanden waren, nahm die Energie des Materials ab, als die zusätzlichen Elektronen delokalisierten, wie Nebel, der über eine Broadway-Bühne gepumpt wurde. Anschließend paarten sie sich flüchtig mit Elektronen im Gitter und bildeten Zwei-Elektronen-Kombinationen, sogenannte Doublonen.
Diese wandernden zusätzlichen Elektronen und die Dublonen, die sie ständig bildeten, konnten sich nicht innerhalb des Gitters delokalisieren und ausbreiten, es sei denn, die Elektronen in den umgebenden Gitterplätzen hätten alle ausgerichtete Spins. Als das Material unermüdlich seinen Zustand mit der niedrigsten Energie anstrebte, war das Endergebnis, dass Dublonen dazu neigten, kleine, lokalisierte ferromagnetische Regionen zu erzeugen. Bis zu einem bestimmten Schwellenwert gilt: Je mehr Dublonen durch ein Gitter fließen, desto nachweisbarer wird das Material ferromagnetisch.
Entscheidend war, dass Nagaoka die Theorie aufstellte, dass dieser Effekt auch funktionieren würde, wenn ein Gitter weniger Elektronen als Gitterplätze hätte, was die Forscher jedoch nicht sahen. Aber laut der theoretischen Arbeit des Teams – veröffentlicht Physikalische Überprüfungsforschung im Juni vor den experimentellen Ergebnissen – dieser Unterschied ist auf die geometrischen Eigenheiten des Dreiecksgitters zurückzuführen, das sie im Vergleich zum Quadratgitter in Nagaokas Berechnungen verwendeten.
Das ist ein Moiré
Sie werden in naher Zukunft keine kinetischen Ferromagnete mehr an Ihrem Kühlschrank anbringen können, es sei denn, Sie kochen an einem der kältesten Orte im Universum. Die Forscher untersuchten das ferromagnetische Verhalten des Moiré-Materials bei frostigen 140 Millikelvin.
Für İmamoğlu eröffnet die Substanz dennoch aufregende neue Möglichkeiten zur Untersuchung des Verhaltens von Elektronen in Festkörpern – und in Anwendungen, von denen Nagaoka nur träumen konnte. In Zusammenarbeit mit Eugene Demler und Ivan Morera Navarro, theoretischer Physiker am Institut für Theoretische Physik, möchte erforschen, ob kinetische Mechanismen, wie sie im Moiré-Material ablaufen, genutzt werden könnten, um geladene Teilchen so zu manipulieren, dass sie sich paaren, was möglicherweise den Weg zu einem neuen Mechanismus für Supraleitung weist.
„Ich sage nicht, dass das schon möglich ist“, sagte er. „Da will ich hin.“
- SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
- PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
- PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
- PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
- Quelle: https://www.quantamagazine.org/new-kind-of-magnetism-spotted-in-an-engineered-material-20240110/
- :hast
- :Ist
- :nicht
- :Wo
- ][P
- $UP
- 140
- 2018
- 2020
- a
- Fähigkeit
- Fähig
- Nach
- über
- vorantreiben
- voraus
- ausgerichtet
- ausrichten
- Alle
- neben
- ebenfalls
- an
- machen
- Ein anderer
- auseinander
- Anwendungen
- angewandt
- Anwendung
- SIND
- um
- AS
- At
- Alleen
- ein Weg
- Bar
- Grundsätzlich gilt
- BE
- weil
- wird
- war
- Bevor
- Verhalten
- Bindung
- Bohren
- beide
- aber
- by
- Berechnungen
- namens
- kam
- CAN
- Kandidat
- Verursachen
- sicher
- geändert
- berechnet
- Gebühren
- Klasse
- Mitverfasser
- Zusammenarbeit
- Kopien
- Kombinationen
- kommt
- zwingend
- Abgeschlossene Verkäufe
- Komplex
- konzipiert
- Bedingungen
- Konfiguration
- Kontrast
- cool
- könnte
- erstellen
- erstellt
- Erstellen
- kritischem
- tanzen
- verringert
- Beschreibung
- Verlangen
- Unterschied
- anders
- Entdeckung
- do
- Dabei
- Nicht
- Von
- nach unten
- Fahren
- jeder
- bewirken
- entweder
- Elektronik
- Elektronen
- entstanden
- Ende
- Energie
- entwickelt
- genug
- vorgestellt
- Eugene
- Bewerten
- ÜBERHAUPT
- Jedes
- jeden Tag
- Beispiel
- Austausch-
- unterhaltsame Programmpunkte
- zeigen
- erwartet
- experimentell
- Erklären
- ERKUNDEN
- verlängert
- extern
- extra
- weit
- Schicksale
- Bundes-
- wenige
- Weniger
- Feld
- Felder
- Finden Sie
- Vorname
- Nebel
- Aussichten für
- unten stehende Formular
- gebildet
- gefunden
- für
- voll
- Funktion
- gewonnen
- bekommen
- Go
- Graphene
- hätten
- passieren
- Haben
- he
- seine
- Loch
- Ultraschall
- HTML
- HTTPS
- Jagd
- i
- identisch
- if
- impliziert
- in
- Krankengymnastik
- Institut
- Interaktionen
- intern
- in
- IT
- SEINE
- Japanisch
- Zeitschrift
- Juni
- nur
- nur einer
- gehalten
- Art
- Wissen
- neueste
- Schicht
- Lagen
- LERNEN
- weniger
- Gefällt mir
- Futter
- wenig
- Leben
- Lang
- aussehen
- SIEHT AUS
- senken
- niedrigste
- gemacht
- Zeitschrift
- Magnetfeld
- Magnetismus
- Magnete
- um
- viele
- Ihres Materials
- Materialien
- Kann..
- Messungen
- Mechanik
- Mechanismus
- Mechanismen
- Triff
- Metall
- Metallindustrie
- Kommt demnächst...
- mehr
- vor allem warme
- Bewegung
- viel
- Natur
- Negativ
- Nachbarschaft
- Neu
- weiter
- nicht
- jetzt an
- of
- Offset
- on
- einmal
- EINEM
- einzige
- gegenüber
- or
- Andere
- Andernfalls
- UNSERE
- Gesamt-
- Pablo
- gepaart
- Paarung
- Parallel
- Schnittmuster
- Muster
- dauerhaft
- Phänomen
- Physik
- Ort
- Länder/Regionen
- Plato
- Datenintelligenz von Plato
- PlatoData
- Play
- Spielplatz
- spielend
- Points
- Punkte
- möglich
- potent
- möglicherweise
- Prognosen
- Präsenz
- Produziert
- ausgesprochen
- immobilien
- Resorts
- die
- veröffentlicht
- Quantamagazin
- Quant
- Quantenmechanik
- radikal
- wirklich
- Grund
- Regionen
- verhältnismäßig
- verbleibenden
- Entfernt
- Ausbeute
- wiederholt
- Forschungsprojekte
- Forscher
- Folge
- Die Ergebnisse
- Enthüllt
- Überprüfen
- Risiko
- Regel
- Führen Sie
- Said
- gleich
- sah
- sagen
- Szenario
- Zweite
- sehen
- scheinen
- scheinbar
- gesehen
- Halbleiter
- begleichen
- Schilder
- da
- am Standort
- Seiten
- Sitzend
- SIX
- klein
- So
- etwas
- etwas
- bald
- Raumfahrt
- Wirbelsäule ... zu unterstützen.
- Spins
- Verbreitung
- Verbreitung
- quadratisch
- gestapelt
- Stacks
- Stufe
- begonnen
- Bundesstaat
- Staaten
- bleiben
- seltsam
- Fremder
- Stärke
- Stärken
- stark
- Struktur
- Studie
- Studieren
- Substanz
- so
- Supraleitung
- Umgebung
- Schweiz
- System
- Systeme und Techniken
- Team
- Technologie
- als
- zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit
- Das
- ihr
- Sie
- dann
- theoretisch
- Theorie
- Dort.
- Diese
- vom Nutzer definierten
- Dritte
- fehlen uns die Worte.
- diejenigen
- nach drei
- Schwelle
- Durch
- So
- zu
- gemeinsam
- auch
- gegenüber
- Tracking
- traditionell
- WENDE
- Twist
- XNUMX
- tippe
- für
- Universum
- Universität
- us
- -
- benutzt
- Variieren
- Version
- Versionen
- Gegen
- sehr
- wollen
- will
- wurde
- Wave
- Weg..
- we
- schwach
- webp
- waren
- Was
- wann
- ob
- welche
- während
- WHO
- warum
- werden wir
- mit
- .
- Arbeiten
- gearbeitet
- weltweit
- würde
- noch
- Du
- Ihr
- Zephyrnet